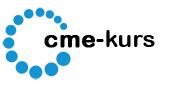Einleitung
Bei Querschnittlähmung nach Rückenmarksverletzung oder neurologischen Systemerkrankungen wie der Multiplen Sklerose (MS) kommt es häufig zu neurogenen Funktionsstörungen des unteren Harntraktes (englisch „neurogenic lower urinary tract dysfunction”, NLUTD). Unbehandelt können diese Störungen je nach Ausprägung zu schweren Komplikationen führen, und die Lebensqualität der Betroffenen kann insbesondere durch eine ausgeprägte Harninkontinenz erheblich beeinträchtigt werden. Neurourologische Funktionsstörungen unterliegen einer individuellen Dynamik und können lebenslange Veränderungen nach sich ziehen. Neurogene Störungen des unteren Harntraktes können initial asymptomatisch sein. Zu den häufigsten Symptomen der NLUTD gehört die neurogene Detrusorüberaktivität (englisch „neurogenic detrusor overactivity”, NDO). Das Krankheitsbild ist im Falle einer erhaltenen Harnblasensensibilität durch imperativen Harndrang gekennzeichnet – ein plötzlich und ohne Vorwarnung einsetzendes, schwer kontrollierbares Dranggefühl, das sogar bis zu einer Harninkontinenz führen kann. Typischerweise geht dies mit einer erhöhten Miktionsfrequenz am Tag und in der Nacht einher und kann einen erheblichen Leidensdruck verursachen. Die Diagnostik der NDO setzt spezialisiertes Fachwissen und eine entsprechende apparative Ausstattung voraus. Bei vielschichtigen Funktionseinschränkungen ist eine interdisziplinäre Herangehensweise (Neurologie, Neurourologie, Orthopädie, Physiotherapie etc.) nötig.
Medikamentöse Therapie
Die für die Behandlung der NDO zugelassenen Anticholinergika umfassen Oxybutynin, Propyverin und Trospiumchlorid. Diese Wirkstoffe zeigen in urodynamischen Untersuchungen eine signifikante Reduktion des maximalen Detrusordruckes sowie eine Steigerung der Blasenkapazität. Bei unzureichendem Ansprechen auf eine Monotherapie kann off Label entweder eine Dosiserhöhung oder eine Kombinationstherapie unternommen werden, was häufig erforderlich ist. Neben der alleinig oralen Medikation kann darüber hinaus eine Kombinationstherapie unter Einbezug oraler, intravesikaler oder transkutaner anticholinerger Applikationsformen erfolgen. Bei Therapieversagen konservativer Maßnahmen sollte der Einsatz interventioneller Verfahren erwogen werden. In Übereinstimmung mit der aktuellen deutschen S2k-Leitlinie „Neuro-urologische Versorgung querschnittgelähmter Patienten” stellt die Detrusorinjektion von Botulinumtoxin A (englisch „botulinum neurotoxin type A”, BoNT-A) die primäre interventionelle Therapieoption dar.
Botulinumtoxin-A-Injektionen bei NDO
Die Injektion von BoNT-A in den Detrusor gewinnt zunehmend an Bedeutung. BoNT-A ist ein Neurotoxin des Bakteriums Clostridium botulinum. Nach Aufnahme in die präsynaptischen Nervenendigungen wird das Toxin in eine schwere und eine leichte Kette gespalten. Die leichte Kette spaltet spezifisch das Protein SNAP-25 (Synaptosom-assoziiertes Protein mit 25 kDa), einen Bestandteil des vesikulären Fusionskomplexes, wodurch die Freisetzung von Acetylcholin an der neuromuskulären Endplatte verhindert wird. Als Resultat wird die Muskelkontraktion reduziert. Die intradetrusorale Injektion von BoNT-A stellt eine etablierte Behandlungsoption bei NDO dar. Ziel der Therapie ist die suffiziente Dämpfung der Detrusorüberaktivität, um eine Verbesserung der Blasenspeicherfunktion und der Kontinenz zu erreichen, sowie eine Reduktion der Detrusordrücke, um den oberen Harntrakt (Nieren) zu schützen. Parallel ist eine begleitende medikamentöse Therapie grundsätzlich möglich und kann im Einzelfall zur Verbesserung des Behandlungsergebnisses beitragen. Für das Therapiemonitoring eignet sich die Blasendruckmessung (Videourodynamik). Hierbei wird aufgezeichnet, wie sich der Blasendruck während der Füllung und der Entleerungsphase verhält. Bei neurogener Detrusorüberaktivität kann ein unwillkürlicher Druckanstieg des Detrusormuskels schon bei geringer Füllmenge auftreten, was auf unkontrollierte Blasenkontraktionen während der Speicherphase hinweist. Eine intravesikale BoNT-A-Therapie wird grundsätzlich ambulant durchgeführt. Bei Patienten mit einer hohen spinalen Läsion, die bereits bei der Diagnostik schon eine autonome Dysreflexie zeigten, sollte die intradetrusorale Injektion von BoNT-A unter Anästhesie-Stand-by erfolgen. Onabotulinumtoxin A und Abobotulinumtoxin A sind beide BoNT-A, die für die Behandlung der NLUTD angewandt werden können. Onabotulinumtoxin A (Onabot/A) ist in der Europäischen Union sowie in der Schweiz unter anderem für die Behandlung der NDO bei Patienten mit Rückenmarksverletzung oder Multipler Sklerose mit einer Dosis von 200 Units zugelassen. Das Zulassungsspektrum von Abobotulinumtoxin A (AboBoNT-A) ist in der Indikation NDO vergleichbar mit Onabot/A, weist jedoch die Einschränkung auf, dass die Behandlung nur bei Patienten erfolgen soll, die regelmäßig einen adäquaten intermittierenden Selbstkatheterismus durchführen. Diese Ergänzung ist als Reaktion auf frühe Zulassungsstudien zu verstehen, in denen eine hohe Rate an Harnverhalten unter BoNT-A beobachtet wurde – insbesondere bei Patienten mit Multipler Sklerose, die präinterventionell noch spontan urinieren konnten. Die Zulassungsstudie für Onabot/A wurde 2011 veröffentlicht, jene für AboBoNT-A im Jahr 2022. In der AboBoNT-A-Studie waren etwa 30 % der Patienten bereits mit einem BoNT-A-Präparat vorbehandelt, was in der Onabot/A-Zulassungsstudie nicht der Fall war. Vergleicht man die Wirksamkeitsdaten beider Studien hinsichtlich der Verbesserung der Harninkontinenz, des maximalen Detrusordruckes und des Blasenvolumens, zeigen sich keine signifikanten Unterschiede. Eine schon konzeptionell sehr diskussionswürdige Studie zeigte einen Unterschied der beiden Präparate im Hinblick auf die Dauer der Wirkung: Hier zeigte Onabot/A eine mittlere Wirkungsdauer von 42 Wochen, AboBoNT-A von bis zu 47 Wochen – eingeräumt wurde zumindest, dass die Terminierung der Nachfolgeinjektionen durch Wartezeiten beeinflusst gewesen sein könnte. Aktuelle systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen (durchgeführt allerdings vornehmlich bei der OAB) kommen zu dem Schluss, dass eine routinemäßige antibiotische Prophylaxe bei intravesikaler BoNT-A-Injektion nicht zu empfehlen ist. Bezüglich des Schmerzmanagements bei Patienten mit erhaltener Blasensensibilität (z. B. bei Multipler Sklerose) wird eine Alkalisierung des Lokalanästhetikums diskutiert. Diese Maßnahme könnte durch eine Erhöhung der Permeabilität der Urothelbarriere zu einer effektiveren Schmerzkontrolle führen. Eine Schmerzreduktion kann teilweise auch durch eine Reduktion der Injektionspunkte gelingen, ohne dabei einen wesentlichen Wirkverlust in Kauf nehmen zu müssen. Die standardisierte Verdünnung von Onabot/A bei der neurogenen Detrusorüberaktivität beträgt 200 Einheiten in 30 ml NaCl, bei AboBoNT-A hingegen 600 bis 800 Einheiten in 15 ml. Unterschiede in der Verdünnung können Einfluss auf die intramurale Verteilung des Toxins haben. Tierexperimentelle Daten legen nahe, dass eine höhere Verdünnung eine diffusere Verteilung im Gewebe bewirken kann. Auch die Injektionstechnik kann das Therapieergebnis beeinflussen. Bei Onabot/A werden dem Beipackzettel zufolge 30 Injektionen à 1 ml appliziert, bei AboBoNT-A beträgt das Injektionsvolumen nach Anleitung 0,5 ml. Üblicherweise variiert jedoch in der Praxis das Injektionsschema erheblich, und viele Anwender verdünnen auch das Onabot/A auf lediglich 10 ml. Der Nadeltotraum variiert je nach verwendetem System und kann bis zu 0,64 ml betragen, was insbesondere bei kleinvolumigen Injektionen berücksichtigt werden sollte. Der Totraum sollte demzufolge mit Luft oder NaCl am Ende der Prozedur nachgespritzt werden, um die Applikation der gesamten Dosis sicherzustellen. Die Blasenfüllung zum Zeitpunkt der Injektion beeinflusst die Wanddicke. Bei einer teilgefüllten Blase (ca. ein Drittel des Füllvolumens) ist die Wand dicker, was eine kontrollierte intramurale Applikation erleichtert. Eine übermäßige Füllung führt zu einer Ausdünnung der Wand und erhöht das Risiko für eine paravesikale Injektion. Eine Metaanalyse zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen den Injektionstechniken direkt in den M. detrusor versus suburothelialen Injektionen in Bezug auf Frequenz, Harndrang, Inkontinenzereignisse, Adhärenz, Blasenkapazität oder maximalen Detrusordruck. Lediglich der Zeitpunkt der ersten Detrusorkontraktion nach Injektion zeigte eine leichte Tendenz zugunsten der suburothelialen Applikation. Auch bezüglich unerwünschter Ereignisse wie Harnwegsinfekten oder Harnverhalt bestehen keine relevanten Unterschiede.
Vorgehen bei Therapieversagen unter Botulinumtoxin-A-Injektionstherapie
Bislang existieren weder einheitliche Kriterien noch konsentierte Schwellenwerte zur Definition eines Therapieversagens unter der BoNT-A-Injektionstherapie bei NDO. Auch in aktuellen Leitlinien finden sich hierzu keine standardisierten Angaben. Eine hilfreiche Orientierung bietet die französische DETOX-Studie (Teil 1 und 2), in der Experten aus der Neurologie befragt wurden, wie sie ein Therapieversagen in diesem Kontext definieren würden. Als konsensbasierte Kriterien wurden u. a. persistierende Detrusorüberaktivitäten mit einem Druckanstieg >40 cm H₂O sowie eine reduzierte Blasencompliance angegeben. Darüber hinaus wurden folgende klinische Parameter mit einem Therapieversagen assoziiert: anhaltende Inkontinenz, Drangsymptomatik, eine hohe Anzahl intermittierender Katheterisierungen (>8/Tag) sowie eine verkürzte Wirkdauer (<3 Monate). Die Ergebnisse verdeutlichen die Heterogenität der Beurteilungskriterien und unterstreichen den Bedarf an prospektiven, multizentrischen Studien mit dem Ziel, valide und einheitliche Definitionen für ein Therapieversagen zu etablieren. Internationale urologische Leitlinien, darunter die der European Association of Urology (EAU), benennen mehrere Optionen zur Behandlung der NDO, darunter die Injektion von BoNT-A. Bei unzureichendem Ansprechen auf eine BoNT-A kann eine Dosiserhöhung innerhalb der zugelassenen Grenzwerte erwogen werden. Kombinationstherapien oder invasive Therapien wie Blasenaugmentation werden in den Leitlinien nur allgemein erwähnt, eine klare Empfehlung als Dritt- oder Viertlinientherapie im Stufenschema bleibt aus. In Einzelfällen kann ein Wechsel (im Folgenden: Switch) des BoNT-A-Präparates (z. B. von Onabot/A zu AboBoNT-A oder vice versa) auf ein anderes zugelassenes BoNT-A-Präparat erwogen werden, auch wenn es hierzu aktuell keine Leitlinienempfehlungen gibt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Einheiten der Präparate nicht äquivalent sind und eine dosisadäquate Umrechnung erfolgen muss. Eine multizentrische Studie untersuchte die Wirksamkeit eines Präparatewechsels bei Patienten mit therapieresistenter NDO. Von 57 eingeschlossenen Betroffenen wechselten 32 das Präparat von Onabot/A zu AboBoNT-A. Die Zufriedenheit und die klinischen und urodynamischen Ergebnisse in der Switchgruppe waren besser als in der Vergleichsgruppe (die das vorherig applizierte Präparat erneut erhielt). Die Inkontinenzepisoden/Tag wurden um 53 % gesenkt, der maximale Blasendruck um 8 cm H2O gesenkt, die Kapazität um 41 ml erhöht. Ein Präparatewechsel kann im Einzelfall und in Abhängigkeit von der verwendeten Dosierung zu einer Verbesserung der subjektiven und klinischen Symptomatik führen, wie eine weitere Untersuchung mit 58 Patienten nahelegt. Hier zeigte sich in der Switchgruppe eine höhere Ansprechrate im Vergleich zur Vergleichsgruppe (52 % vs. 24 %). Ansprechen wurde definiert als das Sistieren von Harndrang, Harninkontinenz und Detrusorüberaktivität bei Patienten, die sich höchstens siebenmal innerhalb von 24 Stunden selbst katheterisierten. Die Richtung des Wechsels (z. B. von Onabot/A zu AboBoNT-A oder umgekehrt) hat dabei offenbar keinen signifikanten Einfluss auf das Behandlungsergebnis. Eine weitere retrospektive Fall-Kontroll-Studie verglich die klinische Wirksamkeit von 750 Einheiten AboBoNT-A mit 200 Einheiten (zugelassene Dosierung bei NDO) oder 300 Einheiten Onabot/A (aktuell keine Zulassung für diese Dosierung). Während beim Vergleich mit 200 Einheiten Onabot/A eine höhere Wirksamkeit von AboBoNT-A bestand, zeigte sich im Vergleich zu 300 Einheiten Onabot/A ein ähnliches Ansprechen mit einem Trend zur längeren Wirksamkeit des Onabot/A. Eine definitive Aussage hinsichtlich der Wirksamkeit beider Wirkstoffe im Vergleich lässt sich aus den bisherigen Daten jedoch nicht ableiten. Aufschluss könnte hier alleinig eine Head-to-Head-Studie bringen.
Fallbericht
48-jährige Frau mit inkompletter Paraplegie ab TH12 im Rahmen eines anterioren Spaltabschlussdefektes (ASAD) nach Meningomyelozele, diagnostiziert im Jahr 2007. Es bestand eine neurogene Dysfunktion des unteren Harntraktes mit ausgeprägten Symptomen wie Dranginkontinenz, imperativem Harndrang, Nykturie sowie rezidivierenden Harnwegsinfekten. Die Patientin führte regelmäßige intermittierende Selbstkatheterisierungen durch und verwendete zusätzlich aufsaugende Hilfsmittel. Im sozialen und beruflichen Umfeld lebte die Patientin in einer Partnerschaft, war Mutter von zwei Kindern und bewegte sich im Alltag mithilfe eines Rollstuhles. Sie war berufstätig als Steuerfachangestellte, berichtete jedoch über eine erhebliche Einschränkung der beruflichen Leistungsfähigkeit aufgrund der bestehenden Blasenfunktionsstörung. Anamnestisch erhielt die Patientin bereits mehrere orale Anticholinergika sowie wiederholt intravesikale BoNT-A-Injektionen. Die applizierte Dosis beträgt etwa 200 Einheiten Onabot/A. Im Rahmen der urodynamischen Diagnostik wies die Blase eine deutlich reduzierte Kapazität von etwa 140 ml auf. Es wurde eine ausgeprägte Detrusorüberaktivität mit einem Maximaldruck von 100 cm H₂O nachgewiesen. Somit wurde eine NDO diagnostiziert. Therapeutisch wurde eine intradetrusorale Injektion von 200 Einheiten Onabot/A durchgeführt. In der nachfolgenden urodynamischen Untersuchung zeigte sich ein deutlich verbessertes Blasenfüllungsverhalten mit einer Kapazität von über 400 ml sowie das vollständige Ausbleiben von Detrusormuskelkontraktionen. Klinisch berichtete die Patientin über eine subjektiv zufriedenstellende Wirkung der Therapie: Es traten keine Inkontinenzereignisse mehr auf, eine intermittierende Selbstkatheterisierung war wesentlich seltener erforderlich, und die berufliche Tätigkeit konnte uneingeschränkt fortgeführt werden. Etwa drei bis vier Monate nach der Injektion kam es zu einer erneuten Zunahme der Symptome. Die Patientin klagte über Rückfälle mit Harninkontinenz, zudem waren wieder häufiger Selbstkatheterisierungen erforderlich. Eine erneute urodynamische Untersuchung bestätigte das Wiederauftreten einer ausgeprägten Detrusorüberaktivität mit Maximaldrücken bis zu 280 cm H₂O sowie eine deutlich reduzierte Blasenkapazität. Ein Vorschlag zur Wiederholung der Therapie mit Onabot/A wurde von der Patientin abgelehnt, woraufhin sie sich für eine Weiterbehandlung in einer anderen Einrichtung entschied. Dort erfolgte eine Injektion von 200 Einheiten Onabot/A. Diese führte zu keiner signifikanten klinischen Verbesserung, obwohl eine erneute urodynamische Kontrolle eine lediglich geringe Detrusorüberaktivität bei einer Blasenkapazität von 140 ml zeigte. Klinisch konnte ein Therapieversagen angenommen werden. Es erfolgte ein Wechsel des BoNT-A-Präparates: Anstelle von Onabot/A wurden 600 Einheiten AboBoNT-A verabreicht. Unter Injektionstherapie mit AboBoNT-A zeigte sich eine deutliche klinische Verbesserung. Die Katheterisierungsfrequenz konnte auf drei Anwendungen pro Tag reduziert werden, die Entleerungsvolumina erreichten annähernd 500 ml. Inkontinenzereignisse traten nicht mehr auf, und die Patientin berichtete über eine deutliche Steigerung ihrer Lebensqualität. Im Langzeitverlauf erhielt die Patientin über mehrere Jahre wiederholte Injektionen, zuletzt mit AboBoNT-A in Dosierungen von 800 Einheiten. Eine Blasenaugmentation wurde thematisiert, jedoch von der Patientin abgelehnt. Zusammenfassend führte der Wechsel von Onabot/A auf AboBoNT-A zu einer relevanten klinischen Verbesserung der Symptomatik. Die langfristige Therapieplanung gestaltete sich jedoch komplex, da standardisierte Kriterien zur Definition des Therapieversagens und evidenzbasierte Vorgaben zum alternativen Vorgehen bislang weitgehend fehlen.
Harnblasenaugmentation als Ultima Ratio
Die Harnblasenaugmentation stellt bei persistierendem Therapieversagen unter konservativen und minimalinvasiven Behandlungsansätzen eine mögliche Option dar, bleibt jedoch ausgewählten Fällen vorbehalten. Aufgrund ihrer invasiven Natur und des damit verbundenen Komplikationspotenzials wird sie in der Regel erst als Ultima Ratio in Erwägung gezogen. In der klinischen Praxis zeigen viele Patienten eine klare Präferenz für weniger invasive Verfahren. Die Indikationsstellung zur Harnblasenaugmentation sollte daher stets unter sorgfältiger Berücksichtigung zum zu erwartenden individuellen Nutzen-Risiko-Verhältnis erfolgen.
Fazit
- Die neurogene Detrusorüberaktivität (NDO) ist ein häufiger neurourologischer Befund bei Querschnittlähmung und anderen neurologischen Erkrankungen und erfordert eine differenzierte, interdisziplinäre Diagnostik und Therapie.
- Ziel der Behandlung ist die Verbesserung der Kontinenz sowie die Vermeidung urologischer Komplikationen.
- Anticholinergika sind etablierte medikamentöse Erstlinientherapien, diese sind jedoch oft limitiert durch Nebenwirkungen oder unzureichende Wirksamkeit.
- Die Detrusorinjektion von Botulinumtoxin A stellt eine effektive und gut verträgliche minimalinvasive Therapieoption bei therapierefraktärer NDO dar.
- In Deutschland sind die BoNT-A-Präparate Onabotulinumtoxin A und Abobotulinumtoxin A zur Behandlung der NDO zugelassen.
- Für das Therapieversagen nach BoNT-A-Injektionen fehlen bislang standardisierte Definitionen; eine individuelle Beurteilung unter klinischen und urodynamischen Gesichtspunkten ist erforderlich.
- Bei unzureichendem Ansprechen auf ein BoNT-A-Präparat sind Dosiserhöhung, Kombinationstherapien mit oralen Wirkstoffen oder ein Präparatewechsel mögliche Strategien.
- Invasive Therapieverfahren wie Harnblasenaugmentation sollten bei fortbestehender Symptomatik erwogen werden, wobei individuelle Patientenfaktoren sorgfältig abgewogen werden müssen.
Bildnachweis
Pixel-Shot - Adobe Stock